|

Die Sozialarbeit
der Jüdischen Gemeinde Weiden
Jahresbericht 2001
Jüdische
Gemeinde in Weiden - Brennpunkt „Migration“
Migration in Deutschland ist schon seit der
Völkerwanderung ein Thema und beschäftigt und erregt die Gemüter immer wieder.
Zeitweise wird es auch als Wahlkampfthema missbraucht.
Wissen wir aus den Zeiten der
Völkerwanderung, dass Migration immer wieder gewaltsam und mit Kriegen verbunden
war, so scheint sie heute nur vordergründig weniger gewaltfrei abzulaufen.
Deutschland - ein Migrationsland - viele
wollen das nicht wahrhaben, weil dies, wie es scheint ihr eigenes
Selbstverständnis in Frage stellt. Und doch ist es so und man könnte daraus
eigentlich Gewinn ziehen, würde man sich vorurteilslos seinen eigenen Ängsten
stellen, diese hinterfragen, statt nur zu polemisieren und mit den Ängsten
der anderen Politik zu treiben.
Die Jüdische Gemeinde Weiden, die seit nun
sieben Jahren viele Erfahrungen im Bereich Migration gesammelt hat, sieht aber
auch die Perspektive der Zuwanderer, könnte somit als Bindeglied zwischen
Gesellschaft und Migranten dienen, würde dies je wirklich gewollt.
Ein Großteil dieser Gesellschaft nimmt
Migranten im wesentlichen als Bittsteller und Bedrohung eigener Lebensbereiche
wahr. Dass diese Menschen - werden sie hier wirklich aufgenommen (das ist auch
unterschiedlich je nach Ausländerstatus) - sich in diese Gesellschaft durchaus
konstruktiv einbringen und mit ihren Steuern auch zum Erhalt dieser
Sozialgesellschaft beitragen, wird weniger gern zur Kenntnis genommen.
Dabei leben auch diese Menschen immer in
einer zwiespältigen Situation. Am Beispiel der jüdischen Kontingentflüchtlinge
versuchen wir dies einmal aufzuzeigen.
Die emotionale
Situation jüdischer Emigranten aus der GUS
Schon zu Sowjetzeiten haben Juden in zwei
Welten gelebt, innere Heimat contra äußerer Heimat. Das heißt, durch die mehr
oder weniger kaschierte Abneigung bis hin zum offenen Antisemitismus erlebten
sie immer wieder, dass die politische Heimat eigentlich keine war, denn ihr
Judentum mussten sie verstecken.
Eine ähnliche Situation erleben sie hier, da
die äußere Welt als fremd und oft als feindlich erlebt wird, meist wird den
Menschen erst hier bewusst, dass Emigration doch mehr ist, als nur eine Reise
ohne Rückfahrkarte.
Übergroßen Erwartungen folgt meist die große Ernüchterung. Sprachschwierigkeiten
lassen sich oft kaum beseitigen, weil man auf einmal feststellt, dass man
innerlich von „Drüben“ nicht Abschied genommen hat. Es kommt hier oft zu
Doublebinds, die eine Selbstfindung in dieser Gesellschaft sehr erschweren. Ohne
Sprache kein Zugang zum neuen System, zur neuen Gesellschaft, das wird häufig
bitter erlebt und führt auch zu Ghettobildungen nicht nur in Großstädten.
In der Erinnerung erscheint dann das
verlassene Land als ein Stück Geborgenheit. Als Fazit lässt sich sagen, fehlende
innere Trauerarbeit verhindert hier die Neueingliederung. Das führt zu einem
großen inneren Loch, in das die Menschen fallen und das häufig auch die
Annäherung und Eingliederung in die Gemeinden verhindert. Dies sind auch die
Erfahrungen von bereits auf Teilzeit arbeitenden russisch-sprachigen
„Telefonseelsorgen“ in den jüdischen Gemeinden Köln und Düsseldorf.
Zudem hilft die drüben erlebte atheistische
Erziehung wenig für die Eingliederung in die jüdischen Gemeinden. Religion wird
häufig als fremd erlebt, das fördert auch nicht das Angenommenwerden durch die
alteingesessenen Gemeindemitglieder. Damit sind neue Schwierigkeiten
vorprogrammiert.
Wie Judith Kessler feststellt:
„.....Ohne Kommunikation mit der Umgebung wird eine Integration aber immer nur
partiell bleiben...... Denn so wie wir Kontaktablehnungen seitens der
etablierten jüdischen Alteingesessenen haben, finden wir sie auch auf der Seite
der Zuwanderer, die unter sich bleiben wollen und eigene Substrukturen bilden.“
Auch wir haben die Erfahrung gemacht, wie
andere in dieser Arbeit, dass Frauen in der Emigration lernfähiger sind, Männer
dagegen verschlossener. Sie hängen oft in einer für sie unerklärbaren Trauer
fest, auf lange Sicht gesehen entsteht hier Suchtgefahr.
Die emotionale
Situation in den Familien
Häufig stellen die Emigranten fest, dass
anerzogene Rollenkonzepte hier nicht mehr stimmig sind. Erziehung funktioniert
anders als im Herkunftsland. Außerdem scheint es eine Besonderheit zu sein, dass
gerade jüdische Emigranten einen hohen Bildungsanspruch an ihre Kinder haben,
der von diesen oft als Druck erlebt wird und nicht ohne weiteres geleistet
werden kann.
Zwar haben jüdische Emigranten nicht die
Schwierigkeit wie andere Migrantengruppen z.B. Türken, dass das neue
Rollenkonzept bei einer Rückkehr in die Heimat nicht anerkannt wird, da sie ihre
Emigration nach Deutschland meist als endgültig betrachten. Jedoch bleibt das
„innere Loch“ der Erziehenden, wenn diese nicht wirklich innerlich voll ihrer
Emigration zugestimmt haben.
Ebenfalls als schwierig erweist es sich, das
unterschiedlich erlebte Rollenverständnis zu erlernen. In den Familien führt
dies oft zu Schwierigkeiten, da Kindern eine unverhältnismäßige Rolle zukommt,
aufgrund ihrer Sprachkenntnisse, müssen sie für ihre Eltern dolmetschen. Dadurch
werden Eltern oft als schwach erlebt. Die Arbeitslosigkeit mitunter beider
Elternteile trägt auch nicht gerade zur besseren Verständigung innerhalb der
Familien bei, gerade wenn unterschiedliche Ansprüche an das Leben „hier“
gestellt werden. Eine Verschärfung der Situation erfolgt dann in der Pubertät.
Nach einiger Zeit sprechen Kinder nur noch
die Sprache der Mehrheitsgesellschaft, auch das führt dann zu Spannungen
innerhalb der Familien, da sich Kommunikationsschwierigkeiten einstellen, daraus
resultieren dann leicht Beziehungsstörungen und zuletzt dann Sprachlosigkeit.
Häufig schämen sich Kinder in bestimmten Altersgruppen der schlechten
Deutschkenntnisse ihrer Eltern und Großeltern. Auch hier verschärfen sich die
Konflikte in der Regel in der Pubertät.
Oft kommen Eltern gegenüber ihren Kindern in
einen Erklärungsnotstand, da manche Situationen bei uns so nicht verstanden und
zugeordnet werden können. Kinder erleben damit ihre Eltern in einem bestimmten
Alter nicht als zuverlässig und Orientierungshilfe. Daraus entstehen dann leicht
Vorurteile gegenüber dem neuen Leben im neuen Land. Diese Vorurteile treffen auf
die Vorurteile der Einheimischen, was sich kontraproduktiv für eine gelungene
Integration auswirkt.
In der Erziehung ist es wichtig, Kindern
einen Rahmen zu geben, innerhalb dessen sie sich bewegen können und gleichzeitig
auch die Begrenzung erleben. Dies ist für Emigranten sehr schwierig, da sich
Rahmenbedingungen hüben und drüben unterscheiden. Ein schnelles Umlernen ist
erforderlich, was oft nicht geleistet werden kann. Soziale Kontrollmechanismen
wie die Familie und Großfamilie funktionieren nicht wie drüben. Hilfsmechanismen
im hiesigen institutionellen System können häufig nicht angenommen werden, da
sie aus dem früheren Lebenskontext nicht bekannt sind, die Sprachkenntnisse
fehlen, oder sie sind negativ besetzt. (z.B. ist der Begriff der Psychiatrie
noch aus Sowjetzeiten mit vielen negativen Erfahrungswerten besetzt)
Kinder und Jugendliche haben aus der
Familie, je nachdem wie die Eltern innerlich der Emigration zustimmen, die
Vorgabe, sich hier zu bewähren. Aus alten Sowjetzeiten funktioniert noch immer
die Anforderung, wie die Eltern sie auch häufig kennen, Juden müssen immer
bessere Leistungen erbringen als die anderen, um beruflich vorwärts zu kommen.
Diesen Anspruch haben die Eltern hier auch an ihre Kinder. Doch was hier nicht
begriffen wird, dass die Sprache eine zusätzlich Barriere ist, die man zuerst
überwinden muss. Passiert dies nicht, so stellt sich Frustration ein.
Letztere schafft besonders unter
Jugendlichen ein „Wir“-Gefühl, Solidarität tut gut und man findet in den eigenen
Gruppen eine Bestätigung. Dieses Verhalten steht aber kontraproduktiv zu einer
gelungenen Integration. In extremen Situationen schließen sich dann leicht
Jugendbanden zusammen, die sich gemeinsam stark fühlen. Dies wird weniger in
kleinen Gemeinden der Fall sein, ist aber sicher in Großstädten eher ein
Problem, da es hier verstärkt auch Jugendliche anderer Nationalität gibt, die
ihrem eigenen Frust ebenso Ausdruck verleihen.
Man kann dies leicht als vorübergehendes
Jugendproblem abtun, aber dabei macht es sich die Mehrheitsgesellschaft zu
leicht. Um verantwortliche Erwachsene für diese Gesellschaft zu gewinnen, müssen
Frustrationen dieser Art möglichst vermieden werden. Außerdem könnte der
Jugendkriminalität wesentlich entgegen gearbeitet werden, wenn Gelder in einer
angemessenen Migrationsarbeit gezielter eingesetzt würden.
Die gesellschaftliche Isolation begünstigt
sehr häufig auch die individuelle. Wenn Gemeinde hier hilfreich eingreifen
könnte, so wird dies oft durch die Sprach-schwierigkeiten behindert. Es schließt
sich ein Teufelskreis, keine genügenden Sprachkenntnisse, keine wirkliche
Integration.
Zudem muss man auch immer bedenken, dass die
Integration in die Gemeinde nur der erste Schritt sein kann. Die politische
Gesellschaft, die diesen Menschen die Zuwanderung angeboten hat, muss ebenfalls
erheblich mehr Verantwortung und Leistung einbringen, außer sie will den
momentanen Zustand in diesem Land verfestigen. Wir als Jüdische Gemeinden, die
eigentlich nicht gleichberechtigte Bestandteile dieser Gesellschaft sind, sollen
Integrationsleistung erbringen, und arbeiten dabei bereits an unserer absoluten
Leistungsgrenze.
Finden wir dabei weiterhin so wenig
Unterstützung bei Politik und Gesellschaft, so kann man in ein paar Jahren mehr
oder weniger beklagen, dass Integration misslungen ist.
Migration und
Gesundheit
Es gibt Langzeitstudien über Migranten,
die sich mit den Zusammenhängen zwischen Migration und Gesundheit auseinander
setzen. Was die Gesundheit dieser Menschen sicher beeinflusst ist der
unterschiedliche rechtliche Status, den einzelne Ausländergruppen hier in der
BRD haben. Rechtsunsicherheit beeinträchtigt eine stabile Gesundheit. So gesehen
sind Ausländer in bestimmten gesundheitlichen Bereichen Risikogruppen.
Auch hier tut sinnvollere Gesetzgebung Not und Geld könnte in Präventionsarbeit
sinnvoller ausgegeben werden.
Unseren Erfahrungen nach können wir auch
hier einiges bestätigen. Danach muss man dabei bei verschiedenen Generationen
unterscheiden.
Die älteren Erwachsenen über 50 Jahre:
sie kommen hierher in einem Alter, in dem sie die wesentliche Sozialisation
hinter sich haben. Die innere Heimat ist gefestigt, das Lebenskonzept
verwirklicht. Trotzdem erleben sie hier oft ein emotionales Loch, denn sie
sind jetzt „Sozialhilfeempfänger“, also Bittsteller. Die Sprache, die man ihnen
hier nicht mehr zutraut und für deren Erlernen es keine staatliche Hilfe gibt,
fehlt ihnen. Bei Krankheiten müssen sie oft einen Dolmetscher mit zum Arzt
bitten. Kommen sie mit ihren Kindern, so haben sie noch die Aufgabe, die
kleineren Enkelkinder zu hüten, doch die Lebenswelten im Vergleich zu den
älteren Enkelkinder sind völlig anders. Hauptsächliche Krankheiten:
-
internistische Erkrankungen
-
verstärkte depressive Erkrankungen,
drohende Vereinsamung
-
massive Altersdepressionen
Die Erwachsenen von 30 – 50 Jahren:
sie kommen hierher, geprägt durch eine Sozialisation von drüben. Beruf und
Rollenkonzepte wurden auch dort erlernt. Hier erleben sie oft eine innere
Zerrissenheit zwischen der Kultur des Herkunftslandes und den Angeboten im neuen
Land. Selbst erleben sie sich als fremd und die vielen Möglichkeiten
begünstigen häufig Ängste und überfordern die Menschen. In den mitgebrachten
Berufen, die hier nicht anerkannt werden, haben sie meist kein Glück und
müssen unterqualifizierte Jobs annehmen, was den eigenen Selbstwert nicht gerade
fördert. Das untergräbt auf Dauer die psychische Gesundheit. Der
Konkurrenzdruck in unserer Gesellschaft ist ihnen meist fremd. Das momentane
Konzept zur Vermittlung der deutschen Sprache fördert nicht die Sprachfertigkeit
von Ausländern. Ungenügende Sprachkenntnisse bedeuten aber, Unsicherheit und
Rückzug aus der Mehrheitsgesellschaft und drohende Isolation. Auch hier gibt es
eine relativ hohe Krankheitsanfälligkeit:
-
internistische Krankheiten, häufig
Krebserkrankungen
-
Burn-Out, Depressionen (bei Männern meist
laviert)
Die jungen Erwachsenen versuchen,
sich hier ihr Leben neu aufzubauen und nehmen leichter inneren Abschied vom
Herkunftsland. Für diese Generation scheint momentan noch alles machbar zu sein,
obwohl auch sie hier erst einmal umlernen, sowohl in Sprache als auch im Beruf.
Inwieweit sie und die Kinder und Jugendlichen von den Problemen betroffen sein
werden, die andere Migrantengruppen kennen, wird die Zukunft erweisen.
Untersuchungen, hauptsächlich aus dem Bereich der Gastarbeitergruppen stimmen
hier nachdenklich.
Demnach werden diese Menschen, die eigentlich als die Generation der Zukunft
gelten auch als „kranke Generation“ bezeichnet. Hier schlägt die
Verunsicherung voll durch. Völlig von den Traditionen des Herkunftslandes
entfernt, von der Mehrheitsgesellschaft nicht angenommen leben sie zwischen zwei
Stühlen. Die Emigrationsgesellschaft, die immer existiert nimmt sie nicht an, da
sie sich entfremdet haben, die Mehrheitsgesellschaft nimmt sie nicht an, da sie
nicht den von ihnen aufgestellten Anforderungen entspricht. Viele von ihnen sind
desorientiert und am Suchen. Jugendliche müssen lernen, beide Gesellschaften,
die der Emigranten und die Mehrheitsgesellschaft zu akzeptieren. Bei ihnen
ist die Suchtgefahr am höchsten.
Gerade hier wird sichtbar, was der
Mehrheitsgesellschaft passieren kann, wenn nicht wirklich ernsthaft
Integrationsarbeit geleistet wird, und zwar Integration, die dem Fremden seine
Wertigkeit in seiner mitgebrachten Kultur lässt und ihn damit vollwertig in
diese Gesellschaft an- und aufnimmt. Es werden auf Dauer gesehen Randgruppen
entstehen, die irgendwann als nicht integrierbar von der Mehrheitsgesellschaft
abgelehnt werden und die man für die entstehenden Kosten z.B. im
Gesundheitswesen verantwortlich machen wird.
Psychosoziale Betreuung – eine große Aufgabe
der Zukunft
Diese Erkenntnisse über den Zusammenhang von Gesundheit und Migration sind
wichtige Voraussetzungen, wenn man mit verstärkter, Zielgerichteter und
qualitativ hochwertiger Migrationsarbeit auch in den jüdischen Gemeinden
beginnt. Diese Arbeit muss auch immer wieder auf ihre Qualität hin überprüft
werden. Das können allerdings kleine Gemeinden kaum leisten, deshalb ist es
wünschenswert, wenn sich hier Arbeitskreise bilden, möglichst erfahrene Leute,
sowohl aus dem Bereich der Zuwanderer, als auch aus dem Bereich der
Alteingesessenen zusammen tun und gemeinsam ein Konzept erarbeiten zur
langfristigen Einbindung von Zuwanderern in die Gemeinden und die politische
Gesellschaft dieses Landes. Dieser Erfahrungsaustausch muss am besten
übergemeindlich passieren.
Die psychische Betreuung der
Neuzuwanderer ist ein Problem, das immer deutlicher in den Vordergrund tritt. In
allen Altersgruppen wird mehr oder weniger schnell klar, dass psychische
Entlastung für die Menschen notwendig ist. Je nachdem wie schnell man hier Fuß
fasst, sich eingliedert, oder es zumindest versucht, die gesunde seelische
Verfassung steht auch hier an erster Stelle, soll die Lebensbilanz positiv
ausfallen.
Die bekannten institutionellen Anlaufstellen
in Deutschland sind dieser Aufgabe meist überhaupt nicht gewachsen. Von den
Migranten werden sie, wie schon erwähnt, als fremd erlebt, da im Herkunftsland
nicht bekannt. Die Sprache ist die zweite Hemmschwelle. Wenn es um Gefühle geht,
so kann man diese am besten in der Muttersprache formulieren.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich
Kranke angenommen fühlen, wenn sie wissen, der Arzt spricht wenigstens ein paar
Worte der eigenen Sprache, wie viel wichtiger ist es dann, zu wissen, mein
Gegenüber kann die Sprache meiner Seele verstehen.
Seelische Entlastung tut Not. Aus den Reihen
der Zuwanderer kommen genügend Spezialisten, die hier eingesetzt werden könnten.
Wir sind z. Zt. am Andenken, wie sich ein sozialpsychiatrischer Dienst in
russischer Sprache organisieren ließe. Ob und wie psychologische Beratung
innerhalb der Gemeinde angeboten werden kann, das ist v. a. auch eine
Kostenfrage, Gemeinden können dies eigentlich nicht leisten, die Betroffenen
noch viel weniger.
Zudem sehen wir, dass die Sozialarbeiter,
die jahrelang in diesem verantwortungsvollen Job aufgerieben werden, dringend
psychische Entlastung in einer laufenden Supervision brauchen. Diesen Menschen,
die tagtäglich mit den Nöten und Ängsten der Klienten konfrontiert werden, droht
das seelische Ausbrennen in ihrem Beruf. Auch hier wäre es folgerichtig, eine
psychologische Betreuung anzubieten, soll die Qualität der Arbeit weiter gut
bleiben. Und auch hier ebenso – eine Frage der Finanzen!
Optimal wäre die Lösung, in einigen
Gemeinden zentrale Beratungs- und Betreuungsstellen dieser Art zu schaffen. Wäre
auch noch machbar, wenn diese muttersprachigen Beratungsstellen bereits
bestehenden institutionellen Beratungszentren zugeordnet wären, dann hätten auch
betroffene Aussiedler Chancen. Dass auch sie russisch-sprachige Betreuung
suchen, wird an der Statistik der beiden zeitweise arbeitenden russischen
„Telefonseelsorge-Stellen“ in den jüdischen Gemeinden Düsseldorf und Köln
deutlich. Auch hier: Wer kommt für die Kosten auf?
Muttersprachige Psychologen und
Psychotherapeuten könnten auch hier Bindeglieder zwischen der
Mehrheitsgesellschaft und den Migranten werden und eine gelungene Integration
fördern.
Aktuelle Situation der Jüdischen Gemeinde
Im Jahr 1990, als die ersten beiden Familien
noch im ungeregelten Verfahren aus der GUS kamen, stand unsere „Mini-Gemeinde“
gemäß ihren Statuten eigentlich vor der Auflösung. Gerade noch 26 Menschen,
wobei davon ca. 60% über 60 Jahre waren, trafen sich nur noch mühsam zu den
hohen Feiertagen und ein reisender Religionslehrer aus Nürnberg versorgte neben
unseren Kindern auch noch die aus den Gemeinden Amberg und Hof mit
Religionsunterricht.
Der September 1994 brachte dann offiziell
die Wende. Seitdem kommen jedes Monat neue Menschen hier in Weiden an und wenden
sich als erstes hier an das Gemeindebüro, von dem sie Unterstützung für das neue
Leben erwarten.
So haben wir seit September 1994 bis
Dezember 2001: 1281 Menschen betreut. Hinter dieser nüchternen Zahl stehen viele
menschliche Probleme und Nöte. Sehr viele davon sind weiter gezogen, da Weiden
wenig Arbeits- oder Qualifizierungsmöglichkeiten bietet, aber die
Anfangsschwierigkeiten haben sie bei uns bewältigt.
Die meisten der Zuwanderer sind
"kopflastig", d.h. in akademischen Berufen tätig und da bietet diese Region sehr
wenig. Die Großstädte sind hier ein Anziehungspunkt, locken sie doch mit Arbeit
und vielerlei Ausbildungsmöglichkeiten, die man hier nicht findet. Zudem kommen
sie alle aus den großen Städten der GUS und können sich an ein kleinstädtisches
Leben nur schwer gewöhnen.
Allein im vergangenen Jahr wurden von der Landesaufnahmestelle in Nürnberg
168
(+ eine Geburt) Menschen nach Weiden geschickt und 134 Menschen (davon
8 Sterbefälle) haben Weiden wieder verlassen. Das ist manchmal frustrierend
in dieser Arbeit. Man regelt die Anfangsbedürfnisse und dann gehen die Menschen
wieder.
Was sie dabei eintauschen ist allerdings die
Geborgenheit einer "kleinen" Gemeinde, die gerade die Älteren in den großen
Städten vermissen.
So stellt sich grafisch die
Altersstruktur zum 31.12.2001 wie folgt dar:
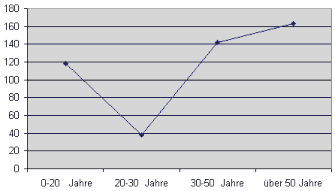 |
|
Alter |
Personen-
zahlen |
Anteil % |
|
0-20 Jahre |
118 |
25,59 |
|
20-30 Jahre |
38 |
8,24 |
|
30-50 Jahre |
142 |
30,80 |
|
über 50 Jahre |
163 |
35,35 |
Von den älteren Erwachsenen wird die
Gemeinde als „Nest“ und Heimat sehr geschätzt, so ist auch unser Seniorenclub
die Gemeindeeinrichtung, die am aktivsten arbeitet.
|