|
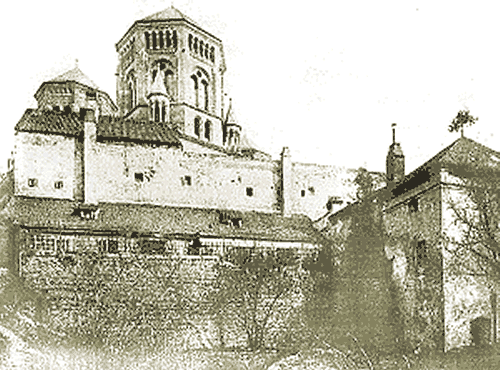
Die Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße:
Städtebaulicher Akzent und Zeichen der jüdischen Emanzipation
Die Synagogenbauten der Neuzeit, nach Wolfram Selig
Nachdem man zunächst daran gedacht hatte, für die
stetig wachsende Gemeinde die bestehende Synagoge zu erweitern, war man von
Seiten der Kultusgemeinde ab Mitte der 1860er Jahre entschlossen, eine neue große
Synagoge zu bauen.
Als geeigneten Bauplatz fand man zunächst ein Grundstück
am Wittelsbacherplatz, das sogenannte "Neusigl-Anwesen". Der Magistrat wurde um
"Einräumung des Bauplatzes" gebeten und gleichzeitig die Bereitschaft betont,
"allen billigen Anforderungen bei dem Bau sich zu fügen, soweit es die
finanziellen und religiösen Verhältnisse der Gemeinde gestatten". Hervorgehoben
wurde, "daß der beabsichtigte Neubau keine Unzierde für die Stadt werden soll".
Am 9.Juli 1869 beschloß der Magistrat der Stadt, "die Eschenanlage zum
Synagogenbau abzulassen, daß aber zuvor noch der Plan vollständig ausgearbeitet
vorgelegt werde".
1870 erwarb daraufhin die Kultusgemeinde dieses Grundstück an
der Nordwestecke des Wittelsbacherplatzes und ließ in den folgenden Jahren
verschiedene Planentwürfe anfertigen. Neben dem "Altmeister des Synagogenbaus in
Deutschland", Edwin Oppler, - er erbaut u.a. die Synagogen in Hannover und
Breslau - wurde auch Professor Emil Lange in München aufgefordert eine Synagoge
zu entwerfen. Die Bebauung des anvisierten Grundstücks wurde dann aber nicht
genehmigt...
"Blühe, gedeihe, wachse, dort wie hier!"
...Nach einem jahrelangen Hin und Her konnte ein geeignetes Grundstück an der
Herzog-Max-Straße erworben werden und am 15. August 1887 teilte die "Verwaltung
der israelitischen Cultusgemeinde" den "verehrlichen Mitgliedern" mit: "Der Bau
der neuen Synagoge ... ist nunmehr glücklich zu Ende geführt. Genial erdacht und
meisterhaft in allen seinen Theilen durchgeführt, sichert das Bauwerk seinem
Schöpfer, dem Architekten Herrn Albert Schmidt, für alle Zeit den Ruf eines
bewährten Meisters seiner Kunst, und reiht sich würdig den hervorragenden
Monumentalbauten der hiesigen Stadt und den großartigen Gotteshäusern an, welche
im Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts in größeren Schwestergemeinden
entstanden sind".
Zum Abschied von der alten Synagoge an der
Westenriederstraße versammelte sich die Gemeinde dort zum letzten Mal am 10.
September zum Gottesdienst. Rabbiner Perles gab dabei die Gefühle wieder, die
wohl die meisten der Anwesenden bewegten: "Wehmüthig-freudige Gefühle bekämpfen
sich in unser aller Herzen. Wir stehen gehobenen Sinnes vor der Erfüllung eines
seit Jahrzehnten in unserer Gemeinde gehegten Wunsches, vor der Erreichung eines
lange verfolgten Zieles, vor der Einweihung einer den Bedürfnissen unserer
Gemeinde entsprechenden großen, herrlichen Synagoge und wir können uns bei dem
Abschiede von dieser alten Synagoge, dem bisherigen Mittelpunkte unseres
Gemeindelebens, eines Gefühles der Rührung, der Ergriffenheit und lasset mich
noch hinzufügen, eines Gefühles der tiefsten Dankbarkeit nicht erwehren".
Die
kleine Gemeinde, die vor 60 Jahren unter großen Opfern diese Synagoge errichtet
habe, sei inzwischen zur größten und bedeutendsten Gemeinde Bayerns geworden und
damit über diesen kleinen, bescheidenen Raum hinausgewachsen.
Nachdem Perles das
Schicksal der Juden in München vom 13.Jahrhundert an skizziert und das rege
Gemeindeleben in der bisherigen Synagoge geschildert hatte, gab er dem Wunsche
Ausdruck: "Blühe, gedeihe, wachse, dort wie hier!"
Fortsetzung:
Die Einweihung der Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße
war nicht nur
ein Fest für die jüdische Gemeinde, sondern eine Feier, bei der Staat und Stadt
durch die Anwesenheit ihrer höchsten Repräsentanten die Gleichstellung der
jüdischen Münchner Mitbürger bekräftigten.
Weitere Bücher von Wolfram Selig
'Arisierung' in München
1937 existierten in München noch über 1800 jüdische
Firmen, vom Einmann-Betrieb eines kleinen Handlungsreisenden bis zum großen
Kaufhaus oder zur Fabrik, die bis 1939 „arisiert“ oder liquidiert wurden.
Wolfram Selig dokumentiert die Eliminierung dieser Gewerbebetriebe. Damit wird
erstmals der Versuch unternommen, für eine Großstadt alle in den einschlägigen
Akten feststellbaren Einzelfälle von „Arisierung“ darzustellen und damit den
Umfang dieser rücksichtslos durchgeführten Enteignung der jüdischen Bevölkerung
in ihrem ganzen Ausmaß zu veranschaulichen. Sie bedeutete letztlich die
Vernichtung der Existenzgrundlage der meisten damals in der Hauptstadt der
Bewegung“ lebenden Juden...
Leben
unterm Rassenwahn
Vom Antisemitismus in der "Hauptstadt der Bewegung".
Die Stadt München, ihr Oberbürgermeister, die Stadtverwaltung, die Behörden und
Institutionen waren unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtübernahme
bestrebt, dem Ruf der "Hauptstadt der Bewegung" auch im Vollzug antisemitischer
Maßnahmen gerecht zu werden. Wolfram Selig berichtet vom Schicksal jüdischer
Familien, die in die Mühlen der antisemitischen Bürokratie gerieten, er
schildert die Auswirkungen der rigiden Verwaltungsmaßnahmen, mit denen die Stadt
München die Existenzgrundlagen der jüdischen Bürger zerstörte, ihre Auswanderung
erzwang oder den Weg in die Vernichtungslager ebnete... |