|
Die Synagogenbauten der Neuzeit
Von der Betstube
zur ersten Synagoge
Hauptsynagoge an der
Herzog-Max-Straße:
Städtebaulicher Akzent und Zeichen der jüdischen Emanzipation
Ohel Jakob:
Die Orthodoxen gründen eine eigene Synagoge
 Quelle:
Synagogen und jüdische Friedhöfe in
München, Kap.: Die Orthodoxe Synagoge an der Herzog-Rudolf-Straße Quelle:
Synagogen und jüdische Friedhöfe in
München, Kap.: Die Orthodoxe Synagoge an der Herzog-Rudolf-Straße
Ein Teil auch der Münchner jüdischen Gemeinde konnte die
Modernisierungen, die in den 1870er Jahren im Gottesdienst eingeführt worden
waren, nicht mitvollziehen. So nahmen sie Anstoß am 1876 eingeführten neuen
Gebetbuch und an der bisher nicht üblichen Begleitung des Gottesdienstes mit
Orgelmusik und Chorgesang.
Die Auseinandersetzungen zwischen den liberalen
Reformern, die sich in der Münchner jüdischen Gemeinde durchgesetzt hatten, und
den Orthodoxen, die auf einem Gottesdienst in der überlieferten Form bestanden,
führten zwar nicht wie anderorten zu einer Abspaltung, aber zur Gründung des
Vereins "Ohel Jakob" innerhalb der Gemeinde 1.
Die orthodoxen Gemeindemitglieder hatten sich seit der
"Modernisierung" des Gottesdienstes in einem Betsaal an der Kanalstraße 29 zu
eigenen Gottesdiensten getroffen. Auf eine Anfrage der Staatsanwaltschaft beim
Landgericht München I, "ob der Betsaal Kanalstraße 29 dahier ein zu religiösen
Versammlungen eines Theiles der Cultusgemeinde bestimmter Ort ist"2, erwiderte
die Kultusgemeinde entsprechend einem Briefentwurf von Rabbiner Perles u. a.:
"Das Rabbinat und die Verwaltung der Cultusgemeinde haben im Interesse des
Friedens und zur Schonung der Gewissensfreiheit von dem ihnen gesetzlich
zustehenden Einspruchsrecht keinen Gebrauch gemacht und auf die Einrichtung und
innere Ordnung des Betsaales keinerlei Einfluß ausgeübt, sodaß sämtliche innere
und äußere Angelegenheiten des Betsaales . . . lediglich von Mitgliedern
desselben geregelt werden"3.
Die Kultusgemeinde distanzierte sich also in
zurückhaltender Weise von den Orthodoxen, deren Kultausübung sie eben nur
tolerierte, aber eigentlich nicht billigte. Diese Distanzierung wurde noch
deutlicher, als die Orthodoxen den — naheliegenden — Versuch unternahmen, die
alte Synagoge an der Westenriederstraße nach dem Neubau der Hauptsynagoge für
ihre Gottesdienste zu mieten. Am 23. August 1887 richteten die "zwei Vorstände
und ein langjähriges Mitglied des in der Kanalstraße dahier aus Privatmitteln
eingerichteten Gotteshauses ... im einstimmigen Auftrage ihrer sämtlichen
Teilnehmer und einer größeren Anzahl von Gesinnungsgenossen"4
ein Gesuch an die
Verwaltung der Kultusgemeinde, diese "wolle die bisherige Synagoge nach
erfolgter Einweihung der neuen Synagoge ... miethweise überlassen"5.
Begründet wurde das Gesuch damit, daß "der Gottesdienst
in der gemeindlichen Synagoge eine vollständige Verwandlung" erfahren habe,
"durch welche eine große Anzahl von Gemeindemitgliedern sich in ihrem Gewissen
gezwungen fühlten, die Synagoge, das einem Theil von ihnen von frühester
Kindheit her hochehrwürdige Gotteshaus zu meiden und sich selbst Stätten der
Andacht zu begründen". Die Antragssteller hielten es nur für recht und billig,
daß sie, nachdem die Gemeindeverwaltung "ihre Bedürfnisse ... in wahrhaft
großartiger Weise" mit dem Bau der Hauptsynagoge befriedigt hatte, die
freigewordene alte Synagoge "zur Befriedigung der religiösen Bedürfnisse der
Minderheit" zu Verfügung gestellt bekämen6.
Aus den Ausführungen der Bittsteller geht hervor, daß die Gemeindeverwaltung
angeblich zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch gewillt war, den alten
Synagogenbau zu erhalten. Es gebe aber — so fahren die Unterzeichner des Gesuchs
fort — Bestrebungen "von anderer Seite, um die Erfüllung unserer Wünsche auf
immer unmöglich zu machen", und so werde versucht, "nachträglich noch die
Veräußerung der alten Synagoge zu veranlassen". Gegen einen Verkauf seien aber
"nahzu alle Gemeindemitglieder". Der bauliche Zustand des Gotteshauses sei zwar
unbefriedigend, sodaß es nicht ohne "erhebliche Reparaturen auf Jahre hinaus in
Gebrauch genommen werden kann", aber mit einem Kostenaufwand von etwa 30.000
Mark könne die Synagoge in einen "auf Generationen hinaus genügenden baulichen Zustand gebracht
werden"7. Die orthodoxen Gemeindemitglieder boten für die mietweise Überlassung
der alten Synagoge eine Jahresmiete von 2.500 Mark auf 12 Jahre an, sowie die
Übernahme der Hälfte der von ihnen veranschlagten Renovierungskosten, also
15.000 Mark. Für die "Ausübung des Cultus" würden keinerlei Kostenansprüche an
die Gemeinde gestellt, außerdem sollte dieser "das unbeschränkte Recht der
Aufsicht und Überwachung des in der Synagoge auszuübenden Gottesdienstes"
eingeräumt werden. Mit Nachdruck wurde schließlich die Gemeindeverwaltung darauf
hingewiesen, daß es auch ihre Pflicht sei, "für die religiösen Bedürfnisse der
Minderheit Sorgen zu tragen"8.
In
einer Anlage zu dem Gesuch erhoben die Unterzeichner die
Forderung nach einer Gebetsordnung in der orthodoxen Synagoge, "in der Weise,
welche bis zu Jahre 1850 in der israelitischen Cultusgemeinde München üblich
war, ohne Benützung von musikalischen Instrumenten nach der Lehre der jüdischen
Weisen geübt"9.
Rabbiner Perles erklärte sich in einer von der Gemeinde
erbetenen Stellungnahme mit der Einrichtung eines besonderen Gottesdienstes für
die "conservative Minorität" auf Kosten der Gemeinde und "unter Aufsicht und
Leitung der Gemeinde und des Rabbinats einverstanden", meinte aber, "die
miethweise Überlassung eines Betlokales Seitens der Gemeinde .. . zur
selbständigen Schaffung eines Gottesdienstes auf eigene Kosten" nicht
befürworten zu können, "da dies der Würde und Autorität der Gemeinde nicht
entspräche und die Verlängerung des gegenwärtig hier bestehenden Zustandes
bedeutete"10.
Wie Rabbiner Perles zeigte auch die mit dieser
Angelegenheit befaßte "Commission für Finanz- und Synagogenwesen" zwar
Verständnis für das religiöse Anliegen der orthodoxen Minderheit, aber ebenfalls
keine Bereitschaft zum Entgegenkommen im Hauptanliegen, eben der Erhaltung der
alten Synagoge. Es gebe keinen Beschluß der Gemeindeverwaltung, "die alte
Synagoge nicht zu veräußern". Es bestehe für die Kultusgemeinde "keine
rechtliche Verpflichtung, neben der räumlich für die Gesamtgemeinde vollkommen
ausreichenden großen Synagoge, in welcher ein wenn auch sogenannter
reformierter, so doch auf dem Boden des Judenthums stehender Gottesdienst
eingerichtet ist, für die der conservativen Richtung angehörenden
Gemeindemitglieder einen besonderen Gottesdienst einzurichten". Es entspräche
aber "den Grundsätzen der Billigkeit" von Gemeindewegen "auch für die
Befriedigung der gottesdienstlichen Bedürfnisse jener Gemeindemitglieder zu
sorgen, welche in Folge religiöser Bedenken an dem Gottesdienste in der Synagoge
sich nicht betheiligen zu können glauben". Ein entsprechender Beschluß sei
bereit nach der Reformierung des Gottesdienstes im Jahre 1876 gefaßt worden".
Dennoch müsse die Frage, ob die alte Synagoge für conservative Gottesdienste zur
Verfügung gestellt werden könne, entschieden verneint werden und zwar aus
zweierlei Gründen: Zum einen könne mit Rücksicht auf die bereits vollzogene
"Gewährung von Ersatz für die Betstühle in der alten Synagoge" durch Betstühle
in der Hauptsynagoge eine Wiedereröffnung der alten Synagoge nicht in Aussicht
genommen werden. Zum anderen, und das war wohl das wesentliche Argument, sei die
Finanzlage der Gemeinde angesichts der Kosten für den Synagogenneubau und der
Notwendigkeit, bei der neuen Synagoge in absehbarer Zeit ein Gemeindehaus bauen
zu müssen, mehr als angespannt. Aus einer hier angeführten Aufstellung geht
hervor, daß die Kultusgemeinde Schulden von ca. einer Million Mark hatte.
"Die Gemeinde schuldet:
- a) an die bayerische Hypotheken und Wechselbank 4 % Annuitätenkapitalien im Betrag von M 321.000.—
- b) aus dem 4 % Synagogen-Baudarlehen 459.500.—
- c) aus dem Kaufe der Häuser No 3 und 5 der Herzog-Max-Straße einen 4 % Kaufschillingsrest von 150.000.—
in Summa M 930.500.—
Bei Aufnahme eines Anlehens von M 130.000 zum Baue des
Gemeindehauses würde sich sonach die Gemeindeschuld auf M 1.060.500.—
erhöhen".
Bei Erhaltung der alten Synagoge sollten "nach den
früher gepflogenen Erhebungen" die Reparaturkosten mindesten 80.000 Mark
betragen, womit sich die Schuldenlast der Gemeinde auf 1.140.500 Mark erhöht
hätte. Die Commissionsmitglieder erklärten, das könne die Gemeinde nicht
tragen, ganz zu schweigen davon, daß sie nicht in der Lage wäre, neben den
laufenden Kosten für den Unterhalt der Hauptsynagoge auch nach die für die alte
Synagoge aufzubringen. Die "Cultusbeiträge" seien ohnehin seit 1880 um 40 %
angehoben worden, eine weitere Anhebung sei nicht zu verantworten.
Angesichts der angespannten Finanzlage schien es den
Verantwortlichen "dringend geboten, das beträchtliche Kapital, welches durch den
Werth der alten Synagoge und des jetzigen Gemeindehauses repräsentirt wird,
durch den baldigen Verkauf dieser Liegenschaften flüssig zu machen, und dadurch
die Mittel zur Erbauung des neuen Gemeindehauses zu gewinnen".
Die Commission schlug zu Befriedigung der Bedürfnisse
der konservativen Gemeindemitglieder vor, "daß mit dem Bau des neuen
Gemeindehauses . . . zugleich auch der Bau eines Betssales verbunden wird".
Diesen könnten die Orthodoxen mitbenutzen "auf Kosten der Gemeinde und unter
Leitung und Aufsicht der Verwaltung und des Rabbinats".
Der Verkauf und damit auch der Abbruch der
Metivier-Synagoge war also beschlossene Sache. Am 29. Oktober 1888 wurden die
Grundstücke Westenriederstraße 7 und Frauenstraße 20 mit den darauf befindlichen
Gebäuden — der Synagoge und dem alten Gemeindehaus — öffentlich versteigert,
"das erzielte höchste Angebot betrug 206.000 Mark", geboten von dem Realitätenbesitzer Anton Riehl 11. Bereits Anfang
1889 wurden die Gebäude abgebrochen.
- 1. L Baerwald, Juden und jüdische Gemeinden in München,
in Lamm a a 0 S 24
- 2. Leo Baeck Institut New York 1849, Betr. Anfrage
der
königlichen Staatsanwaltschaft am Landgericht München, 9.11.1886
- 3. Leo Baeck Institut a a 0 , Antwortentwurf von
Rabbiner Perles, ohne Datum
- 4. Leo Baeck Institut a a 0 , Gesuch 23 August 1887
- 5.
Leo Baeck Institut a a 0 , Bericht der Commission für Finanz- und Synagogenwesen vom 27 November 1887
- 6.
Gesuch vom 23 August 1887 a.a.O. p1
- 7. ebd.. p2f
- 8. ebd.. p8
- 9. ebd.. p6
- 10. Bericht der Commission für Finanz- und
Synagogenwesen
- 11. Häuserbuch Bd. 4, S. 558
Verz. einiger Abb. im Buch:
40 Synagoge an der Westenriederstraße Lavierte Feder
Zeichnung von L Huber, 1889
41 Synagoge an der Westenriederstraße vor dem Abbruch
1889 Aquarell von Puschkin
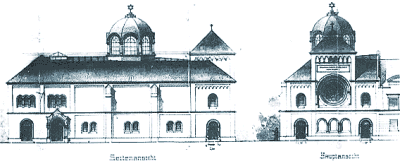
42 Plan für den Bau der orthodoxen Synagoge an der Herzog-Rudolf-Straße,
vormals Canalstraße
Die Orthodoxe Synagoge an der Herzog-Rudolf-Straße
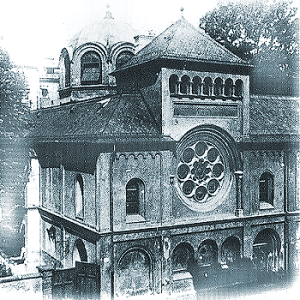
43 Synagoge an der Herzog-Rudolf-Straße
Die orthodoxen Münchner Juden gaben aber nicht auf, sie
wollten eine würdige eigene Synagoge. Dank großzügiger und wohlhabender
Mitglieder — so gehörte u. a. die einflußreiche Bankiersfamilie Feuchtwanger zu
ihnen — konnte bereits 1891 der Grundstein für eine orthodoxe Synagoge an der
Kanalstraße 23 — später Herzog-Rudolf-Straße 3 — gelegt werden, in unmittelbarer
Nähe des bisherigen Betsaales an der Kanalstraße 29. Anläßlich des Richtfestes
für die "Ohel-Jakob-Synagoge" berichtete der Stadtchronist: "Der Erbauer
derselben, Architekt August Exter, hat in derselben den schon bestehenden
Gotteshäusern ein weiteres durchaus würdiges hinzugefügt... Die Länge beträgt
16 Meter, die Breite 12 Meter und die Höhe 19 Meter. Es sind rund 150 Männer-
und Frauensitzplätze vorhanden... Die Facade an der Kanalstraße ist ziemlich
einfach gehalten, der Stil des ganzen ist romanisch"17.
17. Chronik, 28. August 1891, S. 1422
Der Architekt August Exter, geboren am 18. Mai 1858 in
Bad Dürkheim, gestorben am 7. Dezember 1933 in München, machte sich in München
vor allem einen Namen als "Pionier des Einfamilienhauses". So schuf er u. a. die
Villenkolonien I und II in Pasing, außerdem die "Siedlung für den Mittelstand"
in Obermenzing sowie Siedlungen in Laim, Gauting und Gröbenzell. Die Ohel-Jakob-Synagoge war der einzige Sakralbau, den Exter schuf. Weshalb gerade
er mit dem Bau beauftragt wurde, ist nicht bekannt.
Rund 250.000 Mark ließen sich die orthodoxen
Gemeindemitglieder den Bau kosten, ein Vielfaches dessen, was sie 1887 als
Beitrag zur Renovierung der alten Synagoge angeboten hatten, und sie bestritten
die Kosten "aus Eigenem". Einige — so berichtete Rabbinatsassistent Ehrentreu
später bei der Einweihung — hätten "wie es beim Bau des zweiten Tempels geschah,
mit der einen Hand den Bau gefördert mit der anderen gekämpft, unablässig
gerungen und gekämpft, um Schwierigkeiten und Hindernisse . . . wegzuräumen".
Am 25. März 1892 konnte die feierliche Einweihung des
Betsaales des "Vereins zur Förderung der jüdischen Wissenschaft", wie sich Ohel
Jakob auch nannte, stattfinden. Neben Ehrentreu, dem Rabbiner von Ohel Jakob,
sprach auch Gemeinderabbiner Perles, der damit die Zusammengehörigkeit der
gesamten jüdischen Gemeinde verdeutlichen wollte. In seiner Rede rühmte Perles
"die frommen Beter, die mit heiligem Eifer und rühmlichem Opfersinn diese
Andachtsstätte errichtet haben, in welcher sie — eingegliedert in den festen
Verband unserer Cultusgemeinde — doch dem Zuge ihres Herzens folgend, nach der
alten Weise der Väter den Herrn verehren und den Weg zu ihm suchen wollen".
Die Auseinandersetzungen zwischen liberaler Mehrheit und
orthodoxer Minderheit in der Israelitischen Kultusgemeinde, zeitweise mit großer
Schärfe und Intoleranz auf beiden Seiten geführt, ebbten allmählich ab, man kam
nach und nach zu einem friedlichen Nebeneinander. Nach einem erneuten Aufleben
der Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden religiösen Richtungen wurde
schließlich im Jahr 1907 ein "Ausgleich" herbeigeführt, "der hinsichtlich der
Anerkennung der rechtlichen Grundlage für die orthodoxe Synagoge auch die
Zustimmung des Ministeriums gefunden hat". Die Gesamtgemeinde leistete von da an
für die Ohel-Jakob-Synagoge einen regelmäßigen Zuschuß, drei Mitglieder der
orthodoxen Synagoge gehörten auch der Verwaltung der Gesamtgemeinde an.
1917, 25 Jahre nach der Einweihung der Synagoge an der
Herzog-Rudolf-Straße, hatte sich die orthodoxe Gemeinde nahezu verdreifacht, das
in den Ausmaßen doch recht bescheidene Gotteshaus war zu klein geworden, "so
daß, wenn erst wieder normale Verhältnisse eingekehrt sind, wohl mit der
Notwendigkeit der Erweiterung der Synagoge... gerechnet werden muß". Die
Verhältnisse wurden allerdings nicht mehr "normal". Nach dem verlorenen
Weltkrieg war es im Zeichen eines zunehmenden Antisemitismus in immer breiteren
Kreisen kaum mehr möglich, einen Synagogenbau durchzusetzen, ganz abgesehen
davon, daß die jüdischen Deutschen ebenso unter den wirtschaftlichen Folgen des
verlorenen Krieges litten, wie ihre Landsleute. Schließlich war Ohel Jakob ja
als "Verein" stärker von den Zuwendungen seiner Mitglieder abhängig, als die
Gesamtgemeinde.
Die Synagoge der Münchner Ostjuden
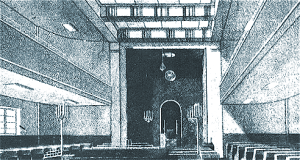
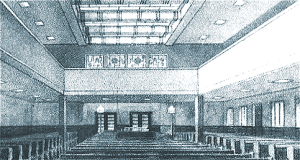
Und doch sollte in München noch kurz vor- der
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, bei denen der Antisemitismus ja an
der ersten Stelle ihrer abstrusen politischen Ideen stand, eine weitere Synagoge
erbaut werden.
Nach der Jahrhundertwende hatte die Zahl der Juden in
München erheblich zugenommen. Eine wesentliche Ursache dafür war die Zuwanderung
aus dem Osten, aus Rußland — wo Pogrome viele zur Auswanderung gezwungen hatten
—, aus Österreich und Ungarn. So gab es 1910 unter rund 590.000 Einwohnern der
Stadt 11.083 Juden. 27 Prozent dieser Juden war im Ausland geboren, meist in
Rußland oder Galizien. Eine zweite Zuwanderungswelle von Ostjuden kam nach den
Ersten Weltkrieg aus Rußland, auf der Flucht vor dem bolschewistischen Terror.
Die jüdischen Zuwanderer aus dem Osten konnten sich mit
der Religionsausübung ihrer deutschen Glaubensgenossen nicht anfreunden. Diese
"Ostjuden Münchens brachten das alte Erbteil, die jüdische Tradition. Das
Zusammengehörigkeitsgefühl dieser Juden verband sie auch in dem neuen Milieu zu
einer geschlossenen Gruppe ... Weniger war es die Abneigung der einheimischen
Juden, als vielmehr das Verlangen nach eigenen, wesensgleichen Formen des
Zusammenlebens, das die Ostjuden beherrschte und sie von der bodenständigen
Religionsgemeinde absonderte"1. Sie gründeten daher eigene Betvereine, darunter
als die bedeutendsten "Linath Hazedek" und "Agudas Achim", die eigene Betstuben
unterhielten2.
11 E. Hörn, Wir und unsere Synagoge, in: Das jüdische
Echo 36, 4. September 1931, S. 21
'l W. J. Cahnmann, Die Juden in München 1918—1943, in:
Lamm a. a. 0. S. 33; vgl. ebd. J. Reich, Eine Episode
aus der Geschichte der Ostjuden Münchens, S. 400
Da die Ostjuden keine deutsche Staatsbürgerschaft
besaßen, hatten sie — obwohl sie ein knappes Drittel der Gemeindemitglieder
ausmachten — bis 1918 auch kein Wahlrecht bei den Wahlen zum Gemeindevorstand.
Die Israelitische Kultusgemeinde wurde nur von deutschen Juden geleitet. Erst
nach 1918 gelang es dann, sich mittels einer gemeinsamen Liste der Zionisten,
der deutschen Orthodoxen und der Ostjuden an den Wahlen zum Gemeindevorstand zu
beteiligen3. 1918 wurde auch der "Gesamtausschuß der Ostjuden" gegründet, der
künftig die eigentliche Repräsentanz der Münchner Ostjuden bildete. Ihm gelang
es, "nach jahrelangem Kampf und zäher Arbeit... die Anerkennung der
Mitgliederrechte der Ostjuden in der Israelitischen Kultusgemeinde in München zu
erringen"4, ein nicht leichtes Unterfangen, denn die deutschen Juden standen in
ihrer Mehrzahl ihren Glaubensgenossen aus dem Osten skeptisch wenn nicht gar
feindselig gegenüber, fürchtete man doch — wie sich zeigte, nicht zu unrecht —,
daß die in ihrem Aussehen und Auftreten fremd wirkenden Ostjuden den Antisemiten
willkommenen Anlaß bieten könnten, gegen alle Juden zu agitieren. Letztlich
konnten aber die Anliegen von etwa 2300 Ostjuden zu Beginn der 30er Jahre nicht
mehr ignoriert werden, und so beteiligte sich die Kultusgemeinde dann auch am
Bau der ostjüdischen Synagoge5.
Initiatoren des Baues waren die beiden oben genannten
Betvereine, die in der Reichenbachstraße 27 bereits seit 1914 einen Betsaal
eingerichtet hatten, der "wohl einer Kegelbahn Raum geboten" hätte, "aber für
religiöse Zwecke unmöglich und geradezu entehrend" gewesen sein soll6. Mit dem
Bau der ostjüdischen Synagoge im Hinterhof der Reichenbach-
31 M. Kalter, Hundert Jahre Ostjuden in München
1880—1980, in: Münchner Jüdische Gemeindezeitung 11, September 1980, S. 6
41 Hörn a. a. 0. S. 22
5' ebd. S. 22f.
" ebd.S. 22
88
Leo Baerwald, Rabbiner an der Hauptsynagoge, erflehte
den Segen Gottes für das neue Gotteshaus und seine Gemeinde12.
Namens der Israelitischen Kultusgemeinde und des
Verbandes der Bayerischen Israelitischen Gemeinden beglückwünschte Alfred
Neumeyer die Erbauer und den Architekten "zur Fertigstellung des meisterlich
schönen Hauses, das, entstanden in einer Zeit schwerster Not durch die
Opferwilligkeit eines kleinen Kreises" die Lebenskraft der jüdischen Gemeinde
beweise. Die neue Synagoge sei ein sichtbares Zeichen dafür, daß der ostjüdische
Bevölkerungsteil sich in der Gemeinde wohlfühle. Elias Straus, stell-,
vertretender Vorsitzender der Kultusgemeinde, erinnerte daran, daß diese
Einweihungsfeier "wie nicht wenige jüdische Feste in einer Zeit schwerster,
ungeheuerster Not" abgehalten werde. Dies sei jüdisches Schicksal. Der Bau der
neuen Synagoge erhelle aber "den zähen Lebenswillen unseres Volkes"13.
Straus wie wohl alle bei der Einweihung Anwesende ahnten
nicht, daß ihnen die Zeiten "schwerster, ungeheuerster Not" erst noch
bevorstanden. Am 30. Januar 1933 wurde Hitler, der erklärtermaßen erbittertste
Feind der Juden, zum Reichs-kanzer ernannt. Nach der "Machtergreifung" der
Nationalsozialisten auch in Bayern am 9. März 1933 dauerte es nur noch etwas
mehr als 5 Jahre, bis die Münchner Synagogen durch Abbruchkommandos oder Feuer
aus dem Stadtbild getilgt wurden.
Wie weit die Feier der Einweihung einer Synagoge schon
im Jahr 1931 außerhalb der allgemein interessierenden Ereignisse stand, zeigte
sich darin, daß die größte der Münchner Tageszeitungen, die
121 Die Einweihung der Reichenbachschul, in: Das
Jüdische Echo 37, 11. September 1931, S. 25
"' ebd.
Münchner Neuesten Nachrichten, von diesem Ereignis überhaupt keine Notiz
nahm. Die jüdische Konfession war wieder einmal weit davon entfernt,
gleichberechtigt neben den christlichen Kirchen zu stehen. Der Weihe der Kirche
der heiligen Familie in Neuharlaching am 6. September des gleichen Jahres
widmeten die Neuesten Nachrichten natürlich einen ausführlichen Artikel14.
Die Zerstörung der Münchner Synagogen
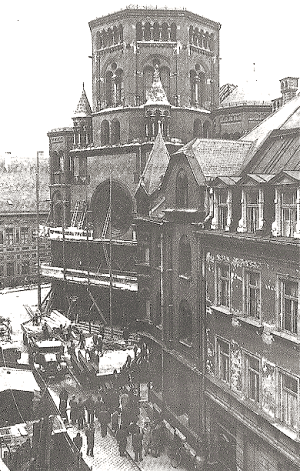
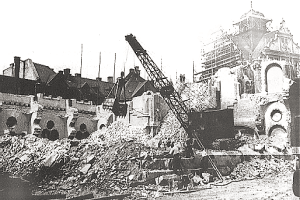



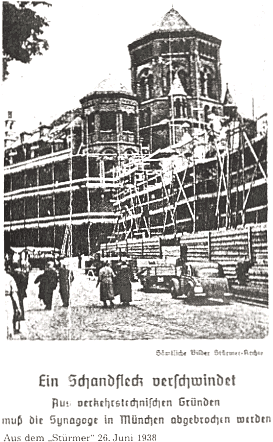

Als die Israelitische Kultusgemeinde 1937 der Errichtung
der Hauptsynagoge vor 50 Jahren gedachte, war die Lage der Juden katastrophal
geworden. Sie waren wieder, wie so oft in ihrer Geschichte, offener Verfolgung
ausgesetzt, waren aus dem Wirtschaftsleben, aus Kultur und Wissenschaft
weitgehend verdrängt und durch die "Nürnberger Gesetze" auch wieder zu
Staatsbürgern und Menschen "minderer Art" degradiert.
In dieser Situation der Bedrängnis und Verfolgung konnte
der glanzvollen Feierlichkeiten 50 Jahre zuvor nur mit Wehmut gedacht werden. In
einer äußerst bescheidenen Festschrift zeichneten die führenden Persönlichkeiten
der Gemeinde die wechselvolle Geschichte des Münchner Judentums nach, die 1887
mit der Einweihung der Hauptsynagoge einen so hoffnungsvollen Höhepunkt erreicht
hatte. Im Vorwort zu dieser Schrift stellten die Herausgeber fest: "Die 50.
Wiederkehr dieses Tages festlich zu begehen, ist heute nicht die Zeit. Nur in
feierlicher Stunde im Gotteshaus selbst soll die Bedeutung dieses Jubiläums
gewürdigt werden"!. Und Rabbiner Baer-


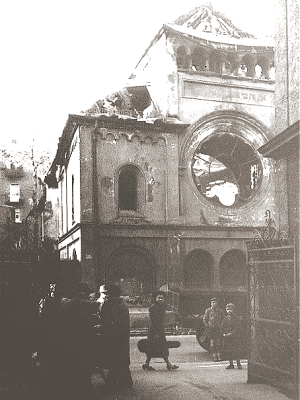
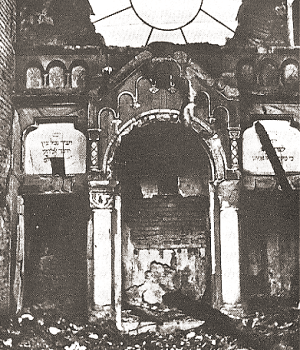
141 vgl. Münchner Neueste Nachrichten 5.—8. September
1931
11 Hauptsynagoge S. 51



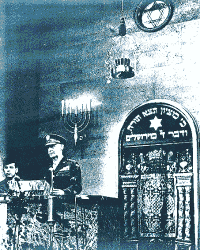
95 |